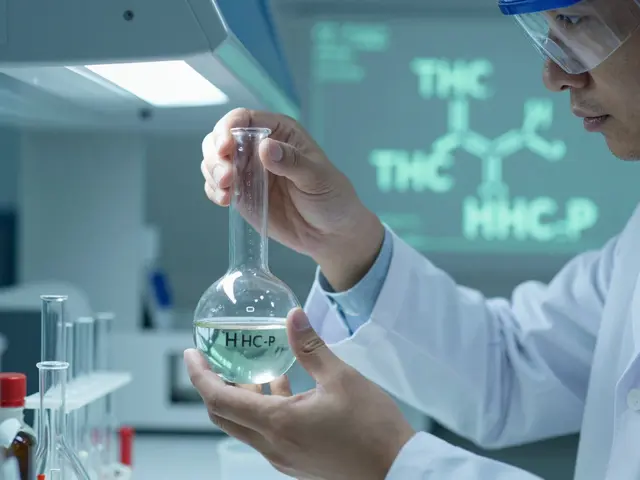Wenn Sie sich jemals gefragt haben, welches Cannabinoid die größte Wirkung entfaltet, sind Sie nicht allein. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler immer neue Verbindungen aus der Cannabispflanze entdeckt - und eines davon, THCP, sprengt dabei alle bisherigen Erwartungen. Dieser Artikel erklärt, warum THCP das stärkste Cannabinoid ist, wie es im Vergleich zu den bekannten Verbindungen abschneidet und welche praktischen Konsequenzen das für Nutzer, Mediziner und Gesetzgeber hat.
Was ist das stärkste Cannabinoid?
THCP ist ein naturbelassenes Cannabinoid, das 2019 von italienischen Forschern entdeckt wurde. Es unterscheidet sich von Δ9‑THC durch eine verlängerte, sieben‑statt‑fünf‑Kohlenstoff‑Kette, was zu einer wesentlich höheren Affinität für den CB1‑Rezeptor führt. In Laborversuchen zeigte THCP eine Bindungsstärke von etwa 30‑mal höher als Δ9‑THC, wodurch es als das derzeitige stärkste bekannte Cannabinoid gilt.Die Entdeckung hat nicht nur das wissenschaftliche Verständnis der Cannabinoid‑Rezeptor‑Interaktion erweitert, sondern auch praktische Fragen zu Dosierung, Sicherheit und rechtlichen Rahmenbedingungen aufgeworfen.
Überblick über die wichtigsten Cannabinoide
Um THCP richtig einordnen zu können, werfen wir einen Blick auf die anderen Hauptakteure der Cannabispflanze.
Δ9‑THC ist das klassisch psychoaktive Cannabinoid, das für die meisten Rauscheffekte verantwortlich ist. Es bindet an den CB1‑Rezeptor mit einer Affinität von etwa 1 (Referenzwert). CBD (Cannabidiol) ist nicht‑psychoaktiv, wirkt aber entzündungshemmend und angstlösend. Es hat kaum Affinität zu CB1, beeinflusst jedoch indirekt das Endocannabinoid‑System. CBN (Cannabinol) entsteht beim Abbau von THC und besitzt leichte sedierende Eigenschaften. Seine CB1‑Affinität liegt bei etwa 0,3 des THC‑Werts. THCV (Tetrahydrocannabivarin) hat eine kürzere Seitenkette als THC und wirkt bei niedrigen Dosen als Antagonist, bei höheren Dosen jedoch leicht agonistisch. Die CB1‑Affinität liegt bei ca. 0,2‑0,5 des THC‑Werts. CBGA (Cannabigerolsäure) ist das Ausgangs-Precursor‑Molekül, aus dem alle anderen Cannabinoide biosynthetisch entstehen. Es hat keine direkte Wirkung auf die Rezeptoren, ist aber zentral für die Pflanzenbiochemie.Vergleich von Potenz und CB1‑Affinität
| Cannabinoid | CB1‑Affinität (relativ zu THC) | Entdeckt | Häufigkeit in Blüten % | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| THCP | ~30 | 2019 | 0,01‑0,05 | Sehr hohe Potenz, noch wenig erforscht |
| Δ9‑THC | 1 | 1964 | 10‑20 | Standard‑Psychoaktivität |
| THCV | 0,2‑0,5 | 1975 | 1‑2 | Appetitzügler‑Potential |
| CBD | ~0 | 1940 | 5‑15 | Entzündungshemmend, nicht psychoaktiv |
| CBN | 0,3 | 1898 | 0,5‑1 | Sedativ, entsteht beim Alterungsprozess |
Warum THCP stärker ist als THC
Die entscheidende Komponente ist die verlängerte Alkylkette. Während THC eine fünf‑Kohlenstoff‑Kette besitzt, hat THCP sieben Kohlenstoffe. Diese zusätzliche Länge ermöglicht eine bessere Passform in das hydrophobe Bindungsloch des CB1‑Rezeptors. Studien zeigen, dass die Bindungsenergie um das 10‑fache steigt, was die receptor‑induzierte Signalübertragung deutlich verstärkt.
Ein weiterer Faktor ist die höhere Lipophilie von THCP. Das Molekül löst sich leichter in den Zellmembranen, gelangt schneller in das zentrale Nervensystem und erreicht höhere Konzentrationen im Gehirn.

Einfluss von Dosierung, Konsummethode und Metabolismus
- Dosis: Da THCP etwa 30‑mal potenter ist, reicht bereits eine Mikrogramm‑Dosis, um starke Effekte zu erzeugen. Die übliche THC‑Dosis von 5‑10mg entspricht bei THCP etwa 0,2‑0,3mg.
- Konsummethode: Beim Vaporisieren wird die Temperatur entscheidend. THCP hat einen leicht höheren Siedepunkt (≈ 220°C) als THC (≈ 157°C). Eine zu niedrige Temperatur kann die Freisetzung verringern.
- Metabolismus: Beide Moleküle werden in der Leber zu 11‑Hydroxy‑Metaboliten umgewandelt, die ebenfalls aktiv sind. THCP‑Metaboliten zeigen jedoch ein noch stärkeres CB1‑Affinitäts‑Profil, was die Wirkdauer verlängert.
Rechtliche Lage und Sicherheitsaspekte
In den meisten Ländern ist THCP nicht explizit gelistet, weil es erst nach der Einführung vieler Cannabinoid‑Gesetze entdeckt wurde. Viele Jurisdiktionen betrachten jedoch alle nicht‑THC‑ähnlichen Cannabinoide, die eine CB1‑Affinität besitzen, als kontrollierte Substanzen. In Deutschland fällt THCP unter das Neue‑Psychopharma‑Gesetz (NpSG) und ist somit illegal, wenn es nicht für medizinische Forschung zugelassen ist.
Die erhöhte Potenz birgt zudem Risiken:
- Überdosierung kann zu intensiven Angst‑ oder Paranoia‑Zuständen führen.
- Herz‑Kreislauf‑Reaktionen (Tachykardie, Blutdruckanstieg) sind stärker ausgeprägt.
- Langzeitdaten fehlen - mögliche neurotoxische Effekte sind noch nicht erforscht.
Empfehlung: Wer THCP ausprobieren möchte, sollte mit Mikrodosierungen (0,1mg) beginnen, einen Safer‑Use‑Plan haben und im Idealfall ein Labor‑zertifiziertes Produkt wählen.
Praktische Anwendung und Ausblick
Für die Medizin ist THCP besonders spannend, weil eine niedrige Dosis starke Analgesie ohne die üblichen Nebenwirkungen von hohen THC‑Mengen bieten könnte. Klinische Studien an Patienten mit chronischen Schmerzen, Multipler Sklerose und PTSD laufen bereits in einigen europäischen Forschungseinrichtungen.
Im Freizeitbereich könnte THCP eine neue Generation von „Microdose‑Blüten“ ermöglichen - Produkte, die bei mikro‑gramm‑Dosen bereits ein volles High erzeugen. Das könnte das Konsumverhalten verändern und zu sichereren, kontrollierteren Erlebnissen führen.
Verwandte Konzepte und weiterführende Themen
Der Entourage‑Effekt beschreibt, wie Cannabinoide, Terpene und Flavonoide zusammenwirken, um die Gesamtwirkung zu modulieren. THCP kann diesen Effekt verstärken oder abschwächen, je nach Begleitstoffe. Ebenso wichtig ist das Verständnis der biosynthetischen Wege - vom Precursor CBGA über enzymatische Umwandlungen zu THCP, THC oder CBD. Forschungen, die Enzyme wie THCA‑Synthase modifizieren, könnten künftig die Produktion von THCP in kultivierten Sorten erhöhen.
Weitere spannende Themen, die Sie nach diesem Beitrag erkunden können:
- „Cannabinoid‑Profil‑Analyse: Wie man THCP‑Reiche Sorten erkennt“
- „Therapeutische Anwendung von hochpotenten Cannabinoiden bei neuropathischen Schmerzen“
- „Rechtliche Entwicklungen zu neu entdeckten Cannabinoiden in Europa“

Häufig gestellte Fragen
Was genau ist THCP?
THCP (Tetrahydrocannabiphorol) ist ein natürlich vorkommendes Cannabinoid, das 2019 entdeckt wurde. Es besitzt eine sieben‑Kohlenstoff‑Alkylkette, was zu einer etwa 30‑mal höheren CB1‑Rezeptor‑Affinität im Vergleich zu Δ9‑THC führt.
Wie stark ist THCP im Vergleich zu herkömmlichem THC?
Laborstudien zeigen, dass THCP etwa 30‑mal stärker an den CB1‑Rezeptor bindet. Praktisch bedeutet das, dass eine Dosis von ca. 0,2mg THCP einer üblichen 5‑10mg THC‑Dosis entsprechen kann.
Ist THCP legal in Deutschland?
Derzeit ist THCP nicht explizit im Betäubungsmittelgesetz aufgeführt, wird jedoch meist unter das Neue‑Psychopharma‑Gesetz (NpSG) subsumiert, weil es eine hohe CB1‑Affinität besitzt. Der private Besitz ist damit illegal, medizinische Forschung kann jedoch Ausnahmen erhalten.
Welche Risiken birgt eine THCP‑Dosis?
Zu hohe Dosen können intensive Angst, Paranoia, Herzrasen und Blutdruckspitzen auslösen. Da die Wirkung stark ist, empfiehlt sich ein Mikrodosierungs‑Ansatz (0,1‑0,3mg) und ein Safe‑Use‑Plan.
Wie kann ich THCP sicher konsumieren?
Wählen Sie ein Labor‑geprüftes Produkt, beginnen Sie mit Mikrodosen, nutzen Sie ein Vaporizer‑Gerät, das die notwendige Temperatur (≈220°C) erreichen kann, und konsumieren Sie idealerweise in einer vertrauten Umgebung.
Gibt es medizinische Studien zu THCP?
Ja, mehrere europäische Forschungseinrichtungen führen aktuelle Präklinische Studien durch, die die Analgesie‑ und Anti‑Entzündungs‑Effekte bei geringen Dosen untersuchen. Die Ergebnisse sind noch nicht publik, zeigen aber vielversprechende Potenziale.